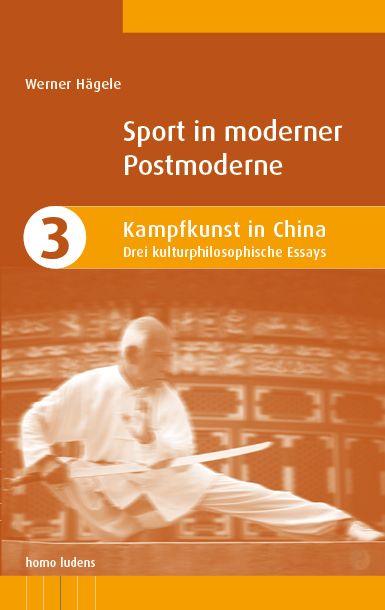Inhaltsverzeichnis
- Einleitung (S. 7-20)
- Soziokulturelle Einflüsse in den chinesischen Kampfkünsten unter besonderer Berücksichtigung von Schamanismus, Konfuzianismus, Taoismus und Chan-Buddhismus (S. 21-82)
- Annäherung an die chinesischen Kampfkünste aus westlicher Sicht (S. 83-112)
- China im Umbruch und die Folgen für die Kampfkünste. Vom Ende des Kaisertums bis zur Gegenwart (S. 113-125)
Schlagwörter
Chinesische Kampfkunst; Kampfspiel; Kampf auf Leben und Tod; Konfuzius; Schamanismus; Taoismus; (Chan-)Buddhismus; westlicher Kampfsport; Geschichte Chinas; republikanisch-kommunistisches China
Inhalt
Die ostasiatischen Kampfkünste erlangten in den letzten Jahrzehnten eine enorme Verbreitung in der westlichen Welt. Ausgelöst wurde dieses Phänomen im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts durch die um sich greifende Postmodernisierung und Globalisierung der Welt, die Ost und West miteinander verband, wie niemals zuvor.
Den ostasiatischen Kampfkünsten kam dabei zugute, dass die 1968er Studentenbewegung und die Flower-Power-Generation der 1970er Jahre in Amerika und Europa bei ihrem Protest gegen das Establishment sowie bei ihrer Suche nach alternativen Lebensformen bevorzugt im süd- und ostasiatischen Kulturkreis fündig wurden.
Im Sport des Westens sorgten die gesellschaftlichen Veränderungen seit Ende der 1970er Jahre dafür, dass neben dem traditionellen Leistungs- und Wettkampfsport der postmoderne Trend- und Outdoorsport entstand. Zu den ersten postmodernen Trendsportarten, die sich im Westen etablieren konnten, zählten die japanisch-koreanischen Kampfkünste. Gleichzeitig gelang dem chinesischen Kung Fu durch Bruce Lee der massenmediale Durchbruch. Doch nur den japanisch-koreanischen Kampfkünsten gelang es, sich im Sportsystem des Westens erfolgreich zu behaupten. Hingegen blieben die chinesischen Kampfkünste, trotz ihres hohen medialen Bekanntheitsgrades, im praktischen Übungsbetrieb für ein breites Publikum weitgehend unbekannt. Zurückzuführen ist dies auf die jahrzehntelange politische Isolation der Volksrepublik China unter Mao Zedong. Erst durch die West-Öffnung Chinas durch Deng Xiaoping seit Ende der 1970er Jahre und dem Aufstieg Chinas zur globalen Wirtschaftsmacht nahm auch das Interesse des Westens an den chinesischen Kampfkünsten in Theorie und Praxis merklich zu.
Als übergeordnetes Leitmotiv liegt den drei Essays das Bemühen zugrunde, die Bedeutung und historische Dimension der chinesischen Kampfkünste dem Leser näherzubringen. Keine ins Detail gehende Chronologie der chinesischen Kampfkünste wird angestrebt, wohl aber wird deren Entwicklung vom chinesischen Altertum bis zur Neuzeit in groben Zügen umrissen. Im Mittelpunkt der Erörterungen stehen nicht Technik und Taktik in Kampf und Training, sondern die Bestimmung jener soziokulturellen Faktoren, die das Selbstverständnis der chinesischen Kampfkünste jahrhundertelang geprägt haben. Eine Schlüsselposition nehmen hierbei die Lehren von Konfuzius und Laotse sowie der taoistische und Chan-buddhistische Weg der Läuterung ein.
Im ersten Essay „Soziokulturelle Einflüsse in den chinesischen Kampfkünsten unter besonderer Berücksichtigung von Schamanismus, Konfuzianismus, Taoismus und Chan-Buddhismus“ wird die vorherrschende Gleichsetzung der Kampfkünste mit dem Weg der Erleuchtung in der japanisch-koreanischen Kampfkunst-Literatur in Frage gestellt. Stattdessen wird die These vertreten, dass der tiefste Urgrund auch der ostasiatischen Kampfkünste in der Bipolarität von gewaltorientiertem Kampf (auf Leben und Tod) und geselligem Kampf (zur bloßen Unterhaltung) liegt. Um- und überlagert wird diese basale Urschicht durch jene philosophischen und religiösen Werte- und Glaubenssysteme, die die Sonderheit in den chinesischen Kampfkünsten bedingen. Die Kerngedanken dieser Philosophien und Religionen werden zunächst allgemeintheoretisch abgehandelt, ehe in einem Zweitschritt ihre Relevanz für die chinesischen Kampfkünste thematisiert wird.
Die gewaltbetonte, aggressive Seite in den Kampfkünsten basiert einerseits auf zahllosen Kriegen und Aufständen in der Geschichte Chinas, andererseits auf der Notwendigkeit, sich gegen Räuberbanden verteidigen zu müssen. Daneben gelang es der unterhaltend-geselligen Seite der Kampfkünste, sich frühzeitig in der chinesischen Kultur zu etablieren.
Der Einfluss des Schamanismus in den chinesischen Kampfkünsten lässt sich bis zur Shang-Dynastie (16.-11. Jh. v. Chr.) zurückverfolgen. Bereits die Wu-Schamanen kannten offenbar Ansätze der späteren „Formen“ („taolu“). Auch die Tierimitationen können auf sie rückdatiert werden. Viele Mythen und Legenden in China weisen einen wuistisch-magischen Hintergrund auf und wurden ein beliebtes Motiv in den Kampfkunst-Choreographien der Hongkonger Filmindustrie.
Die Sitten- und Staatslehre von Konfuzius (um 551-479 v. Chr.) hat wie keine andere politische Theorie die Kultur Chinas geprägt. Ihr Einfluss in den chinesischen Kampfkünsten ist dennoch eher marginal. Dies mag daran liegen, dass das Bildungsideal des edlen Weisen („junzi“) vorwiegend auf die Elite des Landes beschränkt blieb und diese sich im zweiten Jahrtausend den Künsten zuwendete. Hingegen zählten noch bei Konfuzius die praktischen Fertigkeiten, namentlich die Kampfkünste, zum festen Bestandteil seines Erziehungsprogramms.
Konträr zum konfuzianischen Kulturalismus vertritt der philosophische Taoismus von Laotse (um 6. Jh. v. Chr.) und Zhuang Zhou (um 4. Jh. v. Chr.) einen Naturalismus, der in der Leere des Tao die Einheit und Vielfalt der Welt begründet sieht. Um diese Leere in sich und allen Dingen wahrnehmen zu können, bedarf es der Hinwendung zu einem einfachen, ungekünstelten Leben. Hingegen ist überall dort, wo soziokulturell vermittelte Geschäftigkeit sowie Egoismus und Sinneslust dominieren, der Weg des Tao verstellt. Daher gelte es, durch weitgehendes Nicht-Handeln („wu-wei“) den Geist und die Gefühle von allen negativen Einflüssen zu befreien. Wie keine andere Lehre prägte der Taoismus die chinesischen Kampfkünste. Oberstes Ziel der vom Taoismus beeinflussten Kampfkünste ist jedoch nicht die geschmeidige Bewegungsperfektion, sondern eine darüber hinausweisende Läuterung zu einem „wahrhaften Menschen“.
Der religiöse Taoismus erweiterte das Konzept der natürlich-kosmischen Ordnung des Tao um ein Pantheon an Göttern, Geistern und Dämonen und verbreitete die Hoffnung, dass ein wahrhaft geläuterter Mensch Eingang ins Paradies ewiger Glückseligkeit finden könne. Zur späten Han-Zeit (24-220 n. Chr.) überwog noch der Bezug zur äußeren Alchemie und deren Versuchen, Unsterblichkeit mit Hilfe von Elixieren herstellen zu wollen. Seit der Tang-Dynastie (618-906) setzte sich jedoch die innere Alchemie immer stärker durch und damit das Bestreben, mittels Meditation und der größtmöglichen Aufnahme der Lebenskraft „qi“ wahrhafte Läuterung zu erlangen. Die mystisch-religiöse Durchdringung der Kampfkünste, insbesondere in den militanten Geheimgesellschaften, ging mit magisch-alchemistischen Praktiken und Zauberritualen einher. Andererseits fanden heilkundliche Praktiken wie Akupunktur und Akupressur Aufnahme in den Kampfkünsten. Insbesondere erlangte die Tiefenatmung durch Rückgriff auf die Lebenskraft „qi“ eine herausragende Bedeutung.
Dem Chan-Buddhismus, einer Sekte des Mahayanismus, gelang es seit dem 6. Jh. n. Chr. in China Fuß zu fassen. Vom Taoismus übernahm er die Konzeption von der „Leere des Tao“ als dem wahren Sein aller Dinge. Ferner transferierte er Nirvana von einem jenseitig-paradiesischen zu einem diesseitigen, urplötzlich auftretenden Ereignis. Als Geburtsstätte des Chan-Buddhismus sowie der von ihm beeinflussten harten Kampfkünste gilt das Shaolin-Kloster. Berühmt wurde das Kloster durch seine Kampfmönche, die vornehmlich in der Ming-Dynastie (1368-1644) mithalfen, das Land gegen innere und äußere Feinde zu verteidigen. Danach schwand der Rückhalt des Chan-Buddhismus in der chinesischen Bevölkerung, während er in Japan die Kultur und Kampfkunst der Samurai tief geprägt hat.
Im zweiten Essay „Annäherung an die chinesischen Kampfkünste aus westlicher Sicht“ werden nicht, wie in der Fachliteratur sonst üblich, die vermeintlich unüberwindlichen Gegensätze zwischen östlicher Kampfkunst und westlichem Kampfsport herausgestellt. Ausgangspunkt ist vielmehr die These, dass trotz aller Unterschiede Gemeinsamkeiten bestehen, die im Zweikampf als kulturübergreifendem Lebensphänomen begründet sind.
Gewöhnlich sorgen in einem Zweikampf kooperativ-mäßigende Strukturelemente dafür, dass er nicht eskaliert. Bei einem ergebnisorientierten Zweikampf nimmt jedoch die Gefahr, dass die assoziativen Elemente durch Dissonanz und destruktives Verhalten be- und verdrängt werden, umso mehr zu, je wichtiger der Sieg für die Akteure wird. Eher Partner denn Gegner sind die Kämpfenden hingegen im Kampfspiel, in dem die Kurzweil und der Spaß der Protagonisten, nebst der in China langen Tradition der Unterhaltung von Zuschauern, das vordringliche Ziel sind.
Auch der Zweikampf unterliegt den Gesetzmäßigkeiten der bio-kulturellen Ko-Evolution. Als Folge des evolutiven Überlebenskampfes der Menschheit mag eine gewisse Disposition für Kampf und Widerstreit ins genetische Inventar unserer Gattung übergegangen sein. Gleichzeitig ist die Rückkopplung der genetischen mit der kulturellen Evolution unaufhebbar. Die Unterschiede zwischen chinesischer Kampfkunst und westlichem Kampfsport liegen hauptsächlich darin, dass die chinesische Kultur über zwei Jahrtausende vorwiegend durch konfuzianische und taoistisch-buddhistische Wertvorstellungen geprägt wurde, die westliche Kultur hingegen primär durch griechisch-römische und jüdisch-christliche Werte.
Im Besonderen unterscheiden sich die chinesischen Kampfkünste vom westlichen Kampfsport durch die Imitation von Tierbewegungen sowie dem Rückgriff auf ritualisierte „Formen“. Erklären lässt sich die hohe Wertschätzung der Tierimitationen aus der großen Nähe zwischen Mensch und Tier im Schamanismus, aber auch im Taoismus und Buddhismus. Hingegen wurden die Grundlagen für die „Formen“ spätestens durch die Konfuzianer gelegt, die den ekstatischen Tanz ihrer Vorfahren in einen strengen Formalismus der Bewegungen überführten.
Typisch für die chinesischen Kampfkünste sind ferner ihre enge Verbindung mit der Lebenskraft „qi“ und der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM). Basierend auf der Annahme, dass Dysbalancen und Blockaden des „qi“ im Körper zu Krankheit und Tod führen, dienten atemkontrollierte Gymnastikübungen dazu, „qi“-Ungleichgewichte im Körper zu beseitigen. Traditionell weisen die Bewegungen bei diesen Qigong-Übungen nicht nur eine hohe Affinität mit den Bewegungen in den Kampfkünsten auf, vielmehr dienten diese seit alters her auch der Gesundheitsvorsorge.
Bezüglich des Anspruchs edler Selbstvervollkommnung in und durch die Kampfkünste weist die konfuzianische Konzeption des „junzi“ die größte Ähnlichkeit mit Wertvorstellungen auf, die im Westen dem olympischen Kampfsport zugeschrieben werden. Konträr hierzu zielt das Vollkommenheitsstreben im philosophischen Taoismus darauf ab, Harmonie und Einklang mit dem Tao als dem Urgrund allen Seins zu erlangen. Auf ähnliche Weise gilt es im Chan-Buddhismus zum nirvanischen Ich in der kosmischen Leere der Buddha-Natur vorzustoßen.
Zur Eigenart eines Chinesen zählt auch, dass er trotz des Strebens nach Vollkommenheit eines konfuzianischen „junzi“, taoistischen Weisen oder Chan-buddhistischen Erleuchteten ein pragmatisches Verhältnis zu den Geistern, Göttern und Bodhisattvas unterhält, die er im Volksglauben in großer Zahl vorfindet. Insbesondere in den militanten Geheimgesellschaften und Sekten gingen die Kampfkünste eine enge Verbindung mit der Welt der Geister und Götter ein. Die häufige Überlegenheit des Feindes sowie Restriktionen durch den Staat boten den idealen Nährboden für den Glauben an übernatürliche Mächte, deren Unterstützung im Kampf erhofft wurde.
Im dritten Essay „China im Umbruch und die Folgen für die Kampfkünste“ wird die Zeit vom Ende des Kaiserreichs (1911) bis zur Gegenwart thematisiert. Eingeleitet wurde das Ende der Qing-Dynastie (1644-1911) im 19. Jahrhundert durch mehrere verlorene Kriege gegen die europäischen Kolonialisten sowie gegen die Japaner, die im Landesinneren mit zahlreichen politischen Unruhen und Aufständen einhergingen. Durch die Beteiligung vieler Geheimbünde und Freikorps im Kampf teils gegen die Staatsmacht, teils mit ihr gegen die europäischen Eindringlinge, erlangten die Kampfkünste einen großen Zulauf aus allen Bevölkerungsschichten. Gleichzeitig breitete sich das westliche Sportverständnis im Einzugsbereich der von den Europäern besetzten Küstenstädte allmählich aus.
Die republikanische Ära (1912-1949) lässt sich als Richtungskampf konservativer und progressiver Kräfte um das „neue China“ umschreiben. Nach der Machtübernahme durch die Kuomintang-Partei (1928) artete diese Auseinandersetzung zum Bürgerkrieg zwischen Chiang Kai-sheks Nationalisten und den Kommunisten aus, der mit Mao Zedongs Sieg (1949) endete. Die Kampfkünste konnten sich während der Republikzeit noch relativ gut behaupten. Überwiegend betonten sie das beharrende, vergangenheitsorientierte Moment. Dennoch griff die Diskussion um das westliche Sportverständnis auch innerhalb der Kampfkünste um sich.
Mit Gründung der Volksrepublik China (1949) vollzog Mao Zedong nach sowjetischem Vorbild die Gleichschaltung von Staat und Gesellschaft. Insbesondere mit Hilfe der Kulturrevolution (1966-1976) verschärfte er die Verfolgung der bürgerlichen Traditionalisten und Revanchisten. Für die Kampfkünste änderten sich mit der staatlich verordneten Einführung des sowjetischen Sportsystems seit Anfang der 1950er Jahre die sozialen Rahmenbedingungen grundlegend. Fortan breitete sich die westliche Art des Kämpfens flächendeckend über ganz China aus. Trotz der staatlich verordneten Sportausrichtung blieben die traditionellen Kampfkünste jedoch im nicht-organisierten, ländlichen Bereich sowie als Mittel der Gesundheitsvorsorge zumindest bei den Älteren weitgehend erhalten.
Konträr zu Mao Zedongs rigorosem Dogmatismus leitete der Pragmatiker Deng Xiaoping Ende der 1970er Jahre eine Modernisierung der chinesischen Gesellschaft ein, indem er die „sozialistische Marktwirtschaft“ einführte sowie die Öffnung Chinas nach Westen vorantrieb. Dadurch gelang es China bis Anfang des 21. Jahrhunderts, zur zweitgrößten Wirtschaftsmacht aufzusteigen. Die Kampfkünste profitierten von der Reformpolitik Dengs und seiner Nachfolger insbesondere durch deren liberalere Einstellung zu Tradition und Religion, die seit den 1980er Jahren einen massenhaften Zulauf zu Tai Chi Chuan und Qigong auslöste. Im Kampfsport wiederum ermöglichte Dengs West-Öffnung eine Erweiterung des zentralistisch ausgerichteten Sportsystems um nichtstaatliche Elemente der Sportselbstverwaltung. Seit 2013 betreibt Staats- und Parteichef Xi Jinping indes eine Politik der Re-Ideologisierung Chinas, die auch für die traditionellen Kampfkünste und den Kampfsport in China nicht folgenlos bleiben dürfte.